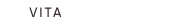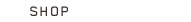Zuerst war da der Schauspieler. Berlin, Freie Volksbühne, »Equus« von Peter Shaffer. Ein Cafe »accu« in der Innenstadt, schwarzer Kaffee, belegte Brötchen. Klaus Hoffmann heißt noch Klaus-Dieter Hoffmann, Anfang zwanzig - skeptisch, neugierig, offen.
Er hatte Bammel vor der Rolle, Schiß vor den gestandenen Kollegen. Am Premierenabend war es für ihn wie im Kino seiner frühen Jahre - es ging um Tod oder Leben, um Sieg oder Niederlage. Klaus Hoffmann siegte. Vorsichtige Annäherung. Was will der Mensch mit dem Kugelschreiber und Schreibblock? Was schreibt der auf, was schreibt er nicht auf und schreibt es dann vielleicht doch? »Eigentlich finde ich so ein Interview Quatsch!« Abtasten. Wortfetzen. Halbe und ganze Sätze. Halbausgesprochenes. Dann plötzlich auch Standpunkte, Ansichten, trotzig, schüchtern, frech. »Manchmal trete ich auch in Clubs auf, so mit Gitarre und singe. Hab' gerade meine erste Platte gemacht. Das Cover-Photo ist scheußlich. Da sehe ich aus wie so ein Teenie-Liebling. Das mache ich nie wieder.«
Und die Lieder? Was singt er? »Lieder, die ich mag. Von Jacques Brel, aber auch eigene. Im Go-In zum Beispiel, spätabends. Mach' ich heute auch noch. Da bin ich ich.« Neugierde auf die Lieder. Noch mehr, als er schließlich von sich selber spricht, als der Kugelschreiber längst eingesteckt ist. Geschichten von Reiserouten gen Osten. Strecken, die vertraut sind. Ausbruch aus dem Mief der jungen Jahre, raus aus der Enge von Schulzeit und Lehre. Rein ins Leben. Oder was man dafür hielt. Ab auf die Straße - Griechenland, Türkei, Iran, Afghanistan. Das Leben - eine einzige Tramptour, eine einzige Wanderung durch die Welt, ins Blaue. Damals begann so etwas wie ein Gefühl von Nähe. Nicht zu dem Schauspieler, nicht zu dem Sänger, aber zu dem Menschen.
Da schien es einen zu geben, dessen Sehnsüchte und Wünsche auf meine trafen. Summe gemeinsamer, wenn auch getrennt erlebter Erfahrungen. Und da war einer, der nicht mit der Masse brüllte, der nicht geübte Routine ablieferte, der sich nur aussetzen wollte - individuell, spontan, freiwillig gewählt.
»Ich glaube, daß die Leute, die meine Lieder hören, eh schon wissen, was die Songs erzählen. Ich sage ihnen nichts Neues. So, wie jedes gute Buch, das dich anspricht, eh nur das erzählt, was du längst schon weißt. Aber es ist wohl meine Aufgabe, meine Wahrheit zu vermitteln, die doch deiner Wahrheit so ähnlich ist. Aber es entsteht etwas Drittes durch das Lied, etwas, das uns verbindet, das uns für Minuten miteinander sein läßt...«
Irgendwann nachts im Go-In. Biergestank, Rauchschwaden, Hitze, Müdigkeit. Dann steht er endlich da, in Jeans und Hemd, die Ärmel hochgekrempelt, die Gitarre umgehängt und fängt an zu singen. Erinnerungen werden abgerufen - die Straße der Kindheit, die Spiele in den Ruinen, die Liebe, die nie sein durfte, die großen Geheimnisse und die kleinen Lügen, die kleinen Fluchten und die großen Ängste. Und neben ihm, auf dem kleinen Podium, standen die, die man verschlungen hatte - Kerouac, Rimbaud, Radiguet, Miller ... und die, denen man lauschte - Brel, Brassens, Ferre, Piaf ...
»Du bist doch gekommen?« Fast ein Staunen nachher, ein schnelles Bier. »Hat's dir gefallen? Wirklich? Ich weiß nicht. Ich glaub', viele hätten lieber sowas wie von Biermann oder von Wader gehört.« »Vielleicht solltest du auf eine richtige Bühne. In ein Theater. Mit Orchester. Nicht nur mit Gitarre, konsequent singen, woran du glaubst, wofür du lebst.« »Ja. ich hab' da schon so ein Idee. Und ein Orchester, also, eine kleine Band, die hab' ich auch. Aber das geht nicht von jetzt auf gleich. Also, tschüss erst mal, ich muß noch mal einen singen.«
Dann geht es los. Nach »Equus« der Romeo, Titelrolle in Ulrich Plenzdorfs »Die neuen Leiden des jungen W.«. Bambi und Goldene Kamera. Ingmar Bergman holt ihn für »Das Schlangenei« vor die Kamera, Peter Beauvais für »Die Soldaten«, Max von Sydow für »Arzt am Scheideweg«. Das Hamburger Thalia-Theater kann ohne diesen Klaus Hoffmann plötzlich nicht mehr sein. Er spielt den Ferdinand in »Kabale und Liebe«, steht neben Erika Pluhar für »Die Kameliendame« vor der Kamera, wird von Michael Heltau in dessen »Liedercircus« geholt, bekommt eine eigene Fernsehshow. Zwischendurch tritt er immer wieder als Sänger auf, werden die Auftrittsorte langst zu klein, drängen sich Fans und Autogrammsammler, ist Klaus Hoffmann plötzlich Liedermacher, Konzertstar, Jugendidol.
»Du, komm doch anschließend mit die in die Kneipe. Da sind wir ganz unter uns, ganz im kleinen Kreis und können in Ruhe quatschen.«
Die Kneipe ist überfüllt. Menschenmassen, Körper, die vorschieben. Irgendwo mitten drin der Sänger, lächelnd, schreibend, händedrückend, atemlos. Ich wage nicht, den Kampf mit den Massen aufzunehmen.
Dann plötzlich Flucht nach vorn. Weg vom Theater, vom Fernsehen, von der Schauspielerei.
»Vielleicht wieder, wenn es eine wirklich starke Rolle gibt. Eine Geschichte, die mir entspricht. Aber so wie in der jetzigen Form - nie wieder. Solange es nicht wirklich Rollen und Stücke sind, mit denen ich mich ebenso identifizieren kann wie mit meinen Liedern, werde ich ausschließlich singen.«
Klaus Hoffmann schert aus. Geht nicht den sicheren Erfolg zum Starruhm, tanzt nicht auf jeder Hochzeit, jeder Party, jedem Schnickschnack, jeder Fernsehserie. Er könnte jahrelang den problembeladenen Jungen spielen, Dutzende von Abziehbildern von Plenzdorfs Bühnenheld. Er wäre immer gut als jugendlicher Liebhaber älterer Damen zu besetzen. Austauschbar. Wenn er gerade nicht frei ist, ist es ein anderer. Und umgekehrt. Er zieht sich zurück. Schreibt, komponiert, reist, lebt. Holt Tträume nach, die zu erfüllen sind. Sucht sich und seine Identität. Spurensuche nach den Ruinen der verlorenen Unschuld.»Ich beschreibe in meinen Liedern nur meine eigenen Erfahrungen. Meine Schwierigkeiten, meine Entwicklungsprozesse. Ich weiß, daß sich die Leute angesprochen fühlen, wenn ich ganz ehrlich und ganz konsequent von mir selbst erzähle.« Seine Texte sind ungeschminkte Erfahrungsberichte. Fragen an sich und an die Umwelt, an das Miteinander, ans Warum nicht? Beobachtungen aus dem Blickwinkel eines Staunenden, Verwunderungen eines Ungläubigen.
Er schafft Distanz zur eigenen Biographie, wird zum Sprecher vielschichtiger Lebensläufe, zum Biograph seiner Generation. Er läuft bewußt auf die Konfrontation mit sich selbst zu, stellt sich immer wieder dem Moment der Entscheidung. Auf der Bühne vergißt er alle Fragen, alle Hemmungen und Ängste. Er ist ganz da - ungehemmt, sicher und stark, doch er bleibt verletzbar. Das Publikum spürt seine Gefährdungen, liebt ihn dafür nur um so mehr. Er singt von der Stadt, in der er lebt, die er lebt und an der er leidet. Von Schmerz. Von Momenten des Glücks. Und von der Zeit dazwischen. Von Frauen, jungen wie alten, von Disco-Mäuschen und Marktweibern. Von Männern, die diesen Frauen nachjagen, von den coolen Städtern, den Geschäftemachern, den Kriegern und von Männern, die Männer lieben. Und immer wieder von sich selbst. Und damit von jedem einzelnen im Publikum.
Berlin, Theater des Westens, irgendwann in den achtziger Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Platten Klaus Hoffmann inzwischen herausgebracht, wie viele Lieder er geschrieben hat. Ich habe seine Lieder immer wieder gehört - in Konzerten, auf dem Plattenspieler. Die Nähe ist geblieben. Leo Ferre singt. Eine Säule des französischen Chansons. Irgendwann, ich hab's noch im Ohr, hat Klaus Hoffmann bei einem Konzert sein Lied «Avec les Temps« auf deutsch gesungen, als x-te Zugabe, als man ihn auch eine Dreiviertelstunde nach eigentlichem Konzertende noch immer nicht von der Bühne ziehen lassen wollte. »Doch mit der Zeit ...« sang er da, hielt er symbolisch das Blatt mit dem Text in der Hand, ein Rattenfänger, dem sein Publikum überallhin gefolgt wäre.
In der Masse steht er plötzlich da. Kein Star. Nur Fan - von dem, der da auf der Bühne steht, sich Seele und Stimme aus der Kehle singt. Uneingeschränkte Bewunderung, Hingabe, Liebe, Verehrung. Außer ihm ist kein deutscher Sänger in dem Konzert. Es leben genug in Berlin, doch keiner hat sich aufgemacht. Nur Hoffmann. Nicht als Hoffmann. Als Klaus - Fan, Verehrer, Liebender.
Da gibt es diesen Moment der Scheuheit wieder. Bei ihm. Bei mir. Aufeinanderzugehen, abbremsen. Dennoch - »ruf mal an. Laß uns mal wieder quatschen. Ich bin die ganze nächste Zeit in der Stadt.«
Vertrautheit, Zuneigung, Distanz: »Männer sind doch nicht gewohnt, sich zu öffnen«, sagt er. »Das starke Geschlecht in meinen Liedern sind immer die Frauen. Aber so wie es bei mir bescheuerte Alte und Spießer mit 18 gibt, so gibt es bei mir unter der Männern wie unter der Frauen Idioten. Nur der Narr, das Kind, wird Sieger sein, indem er liebt.« Von dem Moment an, wo er nicht mehr einfach nur verkörpern wollte, was andere zu erzählen hatten, teilte er mit, was er selbst zu sagen hatte. Dafür gab es den deutschen Kleinkunstpreis und den Deutschen Schallplattenpreis. In Ost-Berlin sang er vor 6000 begeisterten Zuhörern. Auftritte in Frankreich, Griechenland und seine Tourneen bestätigen den Erfolg, den Hoffmann immer versucht herunterzuspielen.
Er will nicht der Star, Folie fremder Träume sein. Will Kumpel bleiben, durch die Straßen latschen können, ohne seinen Namenszug schreiben zu müssen, sein Bier in der Eckkneipe trinken, ohne auf den Sänger im Rampenlicht angsprochen zu werden. Er will frei bleiben, seine Freiheit erhalten, und er weiß doch zugleich, daß er damit an die Grenzen seiner Möglichkeiten stößt. Trotzdem ... Wenn er singt, dann singt er immer noch mit Jacques Brel, dem unvergessenen französischen Chansonnier aus Belgien. Nach Brels Tod hat es auch in deutscher Sprache Nachdichtungen und Interpreten seiner Lieder zuhauf gegehen. Doch Hoffmann sang schon Brel, als dessen Werke noch als Kassengift auf dem deutschen Markt gehandelt wurden.
»Zuerst waren seine Lieder, eigentlich noch mehr seine Stimme, nur so ein Gefühl für mich. Das klang anders als alles, was ich sonst gehört hatte. Dann entdeckte ich seine Texte. Da war einer, der von dem sang, was mich bewegte, der die Ängste und Kümmernisse, den Zorn und das Glück der Leute um mich herum ausdrückte und ihrer Welt eine Sprache gab.«
Brel und Hoffmann. Brel, Sohn aus großbürgerlichem Haus, wohlhabend, die Zukunft verplant, Schritt für Schritt angepaßt - Erziehung, Job, Heirat, Kinder, Glück, Ende. Das wäre es fast gewesen - mit Mitte zwanzig. So hätte es weitergehen können. Doch es erfolgte der Ausbruch, die Flucht nach Paris, die Tage und Nächte im windigen Warten auf die Chance. Schließlich der Durchbruch, die Spitze.
Hoffmann und Brel: »Ich komme aus einem kleinbürgerlichen Berliner Haushalt, bin aber mehr oder weniger mit meiner Mutter aufgewaschen, da mein Vater früh starb. Meine Mutter ist an sich eine Proletarierin, hat in einer Fabrik gearbeitet und nach dem Tod meines Vater einen Mann kennengelernt, der auch Arbeiter war. Ich habe dann irgendwann eine Gitarre geschenkt bekommen, bin in Clubs rumgelaufen, hab' dort ein bißchen versucht, Musik zu machen. Zu Hause habe ich mich nicht sehr wohl gefühlt. In den Clubs hatte ich die Möglichkeit, mich mit anderen Leuten zu unterhalten. Ich hatte ja keine Ahnung von Theater oder Songs und Musik im klassischen Sinne. So bin ich im Grunde erst über andere Künstler dazu gekommen, nachher auch über mich zu schreiben oder über das, was ich für andere empfinde oder gesehen habe.«
Von deutschen Brel-Interpretationen zu eigenen Texten war es nur noch ein kleiner Schritt. Heute sind Hoffmanns Brel-Lieder eine Hommage an sein großes Vorbild, an den unbekannt gebliebenen Vertrauten, von dem er sich längst emanzipiert hat. Die Liebe zu Brel wird sicher bleiben, aber sie hat sich gewandelt. Jetzt singt nicht mehr sein Schüler, sondern sein Freund, Kumpel, Bruder. Geschichtenerzählen. Kaffee, Zigaretten, (für mich), Essen. Ohne Kugelschreiber. Ohne Fragen. Ohne Antworten. Oder - miteinander quatschen, Antworten suchen, hinterfragen.
»Kommste mit schwimmen? Der See ist gleich nebenan. Brauchste 'ne Badehose?« »Nee.« Wer bist du? Wer bin ich? Wer warst du gestern? Wer bist du heute? Mein Bruder ist so alt wie er, Jahrgang 1951, und mir doch fremder, unbekannter. Ich tue mich schwer mit Bezeichnungen.
Da ist der Mensch Hoffmann, der Sänger ist. Ich mag seine Lieder, weil ich sie gelebt habe. Ich mag seine Lieder, weil er sie gelebt hat. Ich mag den Mann Hoffmann, weil ich seine Lieder mag. Weil mir sein Weg vertraut ist, seine Bockigkeit, sein Vertrauen, seine Kindlichkeit, seine Narretei, sein Hinterfragen, sein Einzelgängertum. Weil ich mich ihm verwandt fühle, ohne mit ihm verwandt zu sein. Weil ich ihn auch mag wenn er nicht singt. Und - wenn er nie singen würde.
Dann würde es immer noch spannend sein, mit ihm zu quatschen, ihm zuzuhören, was er sagt und was er fragt, was ihn aufregt, wahnsinnig und glücklich macht, was ihn nervt und bewegt, was er verabscheut und verteidigt. Dafür liebe ich ihn. Schauspieler, Sänger, Texter, Komponist, Veränderungen. Maskenspiele, doch der Blick auf das Gesicht dahinter war immer freigelegt. Zurück zu den Anfängen. Sehnsucht nach dem Spiel. Nach Theater und Film. Nach Aufrichtigkeit. Aufarbeitung des Gewesenen. Ausprobieren im Unbekannten. Totale Hingabe. Ohne Netz. Fehler. Durchatmen. Neuer Anfang. Was war? Was ist gewesen?
Kontrolle über sich selbst. Über die eigene Arbeit. Keine Kompromisse. Kein Wenn und Aber. Kein Schielen nach dem schnellen Erfolg, nach Verkaufbarkeit, nach neuem Trend. Spiegel sein - eigenen Schaffens, eigener Kraft, eigener Verantwortung. Zehn Jahre lang haben andere seine Lieder produziert. Jetzt, wo er für sich selbst die Verantwortung übernommen hat, ist ihm auch die Musik näher. Weg vom Klischee des Liedermachers. Eigentlich wollte er immer Liedersänger sein. Jetzt glaubt er, sich zu hören - will er noch immer Gesang, Spiel und Tanz. Aber nach seinem Rhythmus. »Das ist wie ein neuer Start. Es hat was davon, wie es im Jugendheim Zillestraße war, vor 20 Jahren oder so. Meine Themen sind noch immer dieselben, die Gefühle sind auch noch immer dieselben, aber es gelingt mir leichter, heute schwierige Dinge auszudrücken.«
Poesie und Gefühl, Witz und Nonsens, Spaß und Ungläubigkeit - noch immer, auch 15 Jahre später. Neben Tristesse aber auch Lebensfreude. Glück ohne Zweifel im Zweifel. Leichtigkeit auch im Problematischen. Leben als Komödie, Alltag als Tragigkomödie. Widerstand, Zweifel, aber Hoffnung. Trotz dennoch. Und jetzt erst recht.
( verstorben am 22. 2. 1994 )